Interview Edith Stein Freiburg
aula im Schulalltag:
Schüler-Interview Edith-Stein-Schule Freiburg
Ein Interview mit Tümen und Birhat – Abschlussschüler der Edith Stein Schule Freiburg
Die Edith Stein Schule Freiburg hat im November 2024 mit einem großen Fest der Demokratie den aula-Start gefeiert. Es gab Musik, Essen und Getränke sowie tolle Mitmachaktionen. Zu den Schüler*innen, die aula an ihrer Schule mit eingeführt haben, gehören auch Tümen und Birhat.
Wir haben Tümen und Birhat Fragen zu ihrer Zeit mit aula gestellt. Beide waren zum Zeitpunkt des Interviews in der Oberstufe und kurz vor ihrem Abschluss und engagierten sich als Moderatoren im aula-Prozess.
Erinnert ihr euch noch an die ersten „Wilden Ideen“ an eurer Schule?
Tümen: “An dem Tag als aula vorgestellt wurde, war das besondere, dass Dejan und Tobias uns direkt die Wilden Ideen nähergebracht haben. Was wollt ihr an eurer Schule verändern? Wer hat welche Ideen? Und wer würde diese Idee unterstützen? Wir wurden direkt empowert und haben erst mal gemerkt was für Möglichkeiten man mit aula überhaupt hat. Und da waren dann natürlich alle direkt begeistert.
Birhat: “Wir sind ja eine Berufsschule, und anfangs gab es so eher normaleres – zum Beispiel hatten wir uns schon lange eine Tischtennisplatte gewünscht. Es hieß auch immer, dass die Gelder schon da sind. Aber irgendwie hat sich nie jemand darum gekümmert und aula war so eine Chance, die wir genutzt haben, um diese Idee dann auch wirklich umzusetzen.“
Mit der Begeisterung kam aber auch schnell die Frage: Wie sorgt man dafür, dass Beteiligung im Miteinander respektvoll bleibt? Moderieren heißt auch: Regeln, Schutz, Verantwortung
Zum späteren Zeitpunkt habt ihr beide eine Moderator*innen-Rolle übernommen. Wie war eure Erfahrung mit Diskriminierung und Mobbing? Wurde die Plattform dafür missbraucht?
Tümen: “Bei uns gab es oft Moderator*innen Schulungen, wo wir dann erstmal allen das Thema nähergebracht haben. Also wie geht man in so einem Fall überhaupt vor. Dann haben wir auch einen sicheren Testraum geöffnet für Moderator*innen, wo wir in einem Rollenspiel selbst geübt haben. Aber dann mussten wir es im realen Raum eigentlich nicht anwenden. Wir sind ja auch eine Berufsschule. Alle die bei uns ankommen sind ja schon mindestens 15 oder 16 Jahre alt. Viele sind dort für ihre Ausbildung oder machen das Abitur und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass alle erwachsen genug waren und da ein guter Umgang miteinander da ist.“
Spielt es eurer Meinung nach auch eine Rolle, dass man auf der Plattform nicht völlig anonym ist?
Birhat: „Als wir den aula Vertrag gemacht haben, haben wir bereits eine Netiquette geschrieben und, dass die Accounts der Schüler*innen nachvollziehbar sind und, dass ein Fehlverhalten nicht ohne Konsequenzen bleibt. Also wir haben da klare Regeln aufgesetzt, wann es eine Verwarnung gibt und wann sogar auch einen Verweis von der Plattform, so dass dann auch Schluss ist und das auch mit der Person besprochen wird. Aber ich muss sagen, Tümen und ich waren Moderatoren für die Stufen- und Schulweiten Räume und wir hatten keine Nachrichten oder diskriminierende Ideen, oder etwas das gegen unsere Netiquette war.“
Tümen:“Man musste schon irgendwie überlegen bei dem Benutzernamen. Also er besteht ja aus 3 Buchstaben des Nach- und drei Buchstaben des Vornamen. Und da kann man es bei manchen Leuten schon erahnen, wer das ist, aber es ist irgendwo auch schon ein bisschen anonym. Also hinsichtlich der ganzen Schule kann man dann nicht unbedingt erahnen, wer hinter diesem Account steckt.“
Tümen: „Tatsächlich gab es einen Fall der kurz zu Unsicherheit geführt hat. Als Idee stand dort: „Person X soll allen Nachhilfe geben“ und unsere Lehrerin war sich dann nicht sicher, ob diese Person damit gemobbt wird oder die Person einfach eine guter Schülerin ist und es wünschen sich wirklich alle, dass mit dieser Person regelmäßig gelernt wird? Und da haben wir im Projekt-Team darüber diskutiert, wie wir das machen: Wird so ein Kommentar gelöscht? Also haben wir das dann genutzt, um auch allgemein über schwierigere Nachrichten zu diskutieren, bei denen sich manchmal dann auch die Lehrkräfte uneinig waren.“
Für beide zeichnet sich deutlich ab: Beteiligung bedeutet nicht nur „laufen lassen“, sondern immer wieder gemeinsam abwägen – und klare Regeln vereinbaren.
Was war eine Herausforderung bei der Umsetzung von aula?
Birhat: „aula ist ein Instrument, da denken sich manche Lehrkräfte, dass die Schüler*innen ihnen jetzt sicherlich Macht und pädagogische Freiheiten wegnehmen. Das haben wir versucht so zu lösen, dass wir schon direkt beim Vorstellen von aula alle Lehrkräfte mit abgeholt haben. Also zum Beispiel bei der Gesamtkonferenz. Um ihnen auch zu zeigen: Das wird nicht so schlimm, wie ihr es befürchtet. Wir wollten ihnen auch zeigen, dass nun mal an einer Schule doch 90% der Mitglieder Schüler*innen sind und diese sollten doch auch mitbestimmen können, was an ihrer Schule passiert.“
War die Schüler*innen Vertretung vor aula schon bei der Gesamtkonferenz dabei?
Birhat: „Ich bin jetzt seit fünf Jahren an der Schule und seit drei Jahren im Abiturzweig. Und ich muss sagen, dass durch aula sich auch in der SMV (Schüler*innenvertretung) wirklich etwas verändert hat. Ich war von Anfang an schon immer Klassensprecher und motiviert mich einzusetzen. Als Klassensprecher war es so, dass anfangs alles träge war. Ich hab nie etwas davon mitbekommen dass Schüler*innen bei der Gesamtkonferenzen dabei waren oder, dass die Lehrkräfte – Schüler*innen Beziehung, so wie ich mir das gewünscht hätte, abgelaufen ist.
Ich kann es nicht genau sagen, wie es passiert ist, aber seit wir mit aula angefangen haben, hat es wie ein Katalysator gewirkt. Es hat mich selbst auch mehr motiviert, denn ich konnte an meinen Ideen arbeiten, selbstständig. Ich kann alles machen, wie ich es will. Und das hat auch bei anderen dazu geführt, dass Lehrkräfte auch gesehen haben: Hey unsere Schüler*innen können was, und wollen etwas und dann wurden wir auch immer öfter eingeladen unsere Ideen vorzustellen. Auch von der Schulleitung selbst. Unsere Schulleitung hat wirklich durch aula gemerkt, dass die Schüler*innen etwas bewegen wollen. In der Gesamtkonferenz sind Normalerweise dann ja nur Lehrkräfte und ich weiß natürlich nicht genau wie es dort ist, aber ich glaube das war schon auch oft langweilig. Aber wenn wir Schüler*innen mit dabei sind als frische junge Menschen mit Motivation und dann mitsprechen, das hat auch zu Begeisterung bei den Lehrkräften geführt. Und ich würde schon sagen, dass ist durch aula passiert.“
Von der Idee zur Umsetzung
Mit wachsender Beteiligung kommt auch die Frage auf: Was braucht es, damit eine Idee nicht nur gut klingt, sondern auch durch die nächsten Schritte kommt? Und wie können Moderator*innen dazu beitragen?
Birhat: „Also man musste einmal wirklich verstehen, wie der Prozess abläuft, also wilde Idee, Ausarbeitung, Prüfung und Abstimmung und dann hat man es ja eigentlich auch schon. Mir selbst ist es nicht schwer gefallen, die Phasen durchzusetzen.“
Tümen: „Dazu vielleicht noch, wir sind natürlich vom aula-Team und wir haben ja genau verstanden, was es braucht, um eine Idee so zu verfassen, dass sie durch die nächsten Phasen kommt. Natürlich wissen wir, inwiefern wir die Dinge ausarbeiten müssen hinsichtlich Durchführbarkeit, Finanzierung, Umsetzung etc., und das Problem was wir bei anderen Ideen außerhalb des Teams gesehen haben, war, dass dann die Ideen viel unkonkreter formuliert wurden. Wo man dann als Moderator*in nochmal nachhaken musste und Tipps gegeben hat wie z.B.: Hey formulier das vielleicht nochmal besser aus. Denn das hat man sofort in den ersten Prüfungsphasen gemerkt.
Das war ein wichtiger Punkt bei der Moderator*innen-Schulung, den die Moderator*innen nämlich auch als Aufgabe haben, genau darauf aufmerksam zu machen. Sich innerhalb der Klasse auch direkt an die Schüler*innen zu wenden mit Tipps. Im schulweiten Raum haben das die erfahrenen Moderator*innen übernommen, Birhat und ich z.B. auch.
Es kam aber natürlich trotzdem vor, dass manchmal auch Moderator*innen Ideen eine Phase weiter geschoben haben, auch wenn es noch nicht gut ausgearbeitet war und dann kam es halt auch dazu, dass in der Prüfung die Idee abgelehnt wurde mit dem Grund ‚bitte ausformulieren und nochmal machen‘. Also wir glauben, dass das Problem darin liegt, wenn Moderator*innen nicht zu den Schulungen erscheinen. Und dann einfach alles weiterschieben. Also das kann noch besser werden an unserer Schule.“
Birhat: „Am Anfang wurde aula auch als ‚Problem-Melde-Tool‘ verwendet. Also das auf Baustellen oder Defekte hingewiesen wurde. Wenn z.B. ein Fenster in einem Raum nicht ging. Wir haben es dann so mit der Schulleitung besprochen, dass wir, wenn wir so Problem-Hinweise, die leicht zu beheben sind bekommen haben, die dann direkt lösen, ohne dass sie durch die Phasen müssen und den aula-Prozess durchlaufen. So zum Beispiel wenn die Tür in 103 quietscht, dann halt ok gut, das ändern wir direkt.“
Hier wird sichtbar, was Beteiligung auch braucht: Verbindlichkeit im Prozess – und Menschen, die ihn begleiten zum Beispiel im Rahmen der aula Stunde. Die aula-Stunde: Ablauf, Rhythmus, gemeinsame Verantwortung
Wie lief die aula Stunde bei euch ab?
Birhat: “Wir haben bei uns im aula-Vertrag festgelegt, dass einmal pro Monat für 45 Minuten die aula Stunde stattfindet. Und das immer an einem anderen Tag, damit nicht immer die gleiche Stunde bei einer Lehrkraft betroffen ist und das immer gleichzeitig mit allen Schüler*innen.”
Tümen: „Genau, das sollte wechseln so konnten wir direkt die Angst nehmen, dass es halt immer die gleiche Stunde bei einer Lehrkraft trifft. Wir haben am Anfang auch gemeinsam über den Ablauf von aula-Stunden nachgedacht und dann auch bestimmt, dass eben auch Schüler*innen und Moderatorinnen die Stunden gestalten können. Wir hatten nämlich auch oft den Fall, dass Schülerinnen besser über aula Bescheid wussten als manche Lehrkräfte. Und als Input gab es dann immer: Was gibt’s neues allgemein bei aula? Gibt es neue Ideen zur Ausarbeitung, Ideen zur Abstimmung und habt ihr Gesprächsbedarf? Außerdem wollten wir auch die aula-Stunde selbst schon demokratischer gestalten und so haben wir auch vor der aula Stunde schon darüber abgestimmt, wo der Fokus liegt. Sollen Ideen gesammelt oder ausgearbeitet werden? Sollen wir über etwas diskutieren? Oder braucht es Zeit zum Werbung machen? Außerdem hatten wir eine kreative Phase, in der in Gruppen gearbeitet wurde mit einem digitalen Endgerät pro Gruppe. Die Lehrperson sowie die Moderator*innen unterstützen die Gruppen bei ihrer Arbeit. Und das Wichtigste ist, dass am Ende noch Zeit ist, dass die Ideen gesichert sind und auch wirklich gepostet werden und sich auch Zeit genommen wird, um Dinge zu liken. Weil manchmal scheitern Dinge auch, weil alle posten aber keiner liked. Und dann sollte jede Gruppe auch die nächsten Schritte festhalten, also wie daran jetzt weitergearbeitet wird.“
Birhat: „Außerdem einmal pro Monat sind ja nur 12 Stunden pro Jahr – und unser Schulleiter war tatsächlich sehr optimistisch, dass er das unter bekommt. Außerdem wurde es in den offiziellen Schultimer direkt eingetragen, dass auch wirklich alle immer sehen, wann die nächste aula Stunde stattfindet. Dafür waren wir auch total dankbar, dass die Schulleitung da voll auf unserer Seite war.“

Trotzdem bleibt eine Frage, die viele Schulen beschäftigt: Wie wird Beteiligung wirklich breit — und wie bekommen Ideen Unterstützung, damit sie durch den Prozess getragen werden?
Wie bekommen Ideen mehr Unterstützung?
Birhat: „Unsere Herausforderung ist auch immer noch, dass mehr Schüler*innen aktiv auf der App werden. Und wie bekommen Ideen mehr Likes? Es ist ein bisschen die Frage nach der Werbung. Aber hier braucht es noch weiter gute Ideen. Aber wir beobachten schon auch, dass regelmäßige Events wichtig sind. Immer wenn etwas an der Schule stattfindet, versuchen wir es mit aula zu verknüpfen. Das ist schon wichtig und hilft auch. Und wer versuchen immer regelmäßig die Schüler*innen an aula zu erinnern, aber dafür braucht es ein starkes aula-Team an der Schule mit motivierten Menschen.“
Tümen: „Sie schauen halt in der Freizeit nicht kurz mal auf die aula App – sie müssen schon aktiv darauf hingewiesen werden, z.B. in der aula-Stunde. Obwohl es ja eigentlich relativ praktisch ist. Aber was ich bei uns gut finde, ist, dass es sich etabliert hat, dass wenn z.B. eine Person etwas verändern möchte oder eine Idee hat, dass die Lehrkräfte dann sagen – hey schreib das doch in die aula app! Oder ah, dass kannst du doch mit aula umsetzen.“
Nachwuchs fürs aula-Team: Was bleibt, wenn Engagierte gehen?
Wie findet ihr Nachwuchs für das aula-Team?
Birhat: „Ich möchte ehrlich sein, dass ist gerade bei uns an der Schule und besonders für uns gerade, so kurz vor dem Abschluss, die größte Herausforderung. Wenn ich aula an unserer Schule anschaue, dann sind da viele aktive Schüler*innen tatsächlich aus unserer Klasse. Und wenn man sich fragt, woran das jetzt gerade so liegt, dann wahrscheinlich, weil Tümen und ich wahnsinnig viel Werbung für aula machen. Und wir wollen es schaffen, dass mehr Schüler*innen darüber hinaus aktiv werden. Wie schaffen wir es mehr Schüler*innen zu motiveren? So, dass sie wirklich anfangen dafür zu brennen, denn Demokratie ist ein ehrlich wichtiges Ding. Das willst du eigentlich erleben.”
Tümen: „Natürlich ist bei uns auch das Problem, wir sind eine Berufsschule. Das bedeutet es sind nicht immer alle da. Es gibt viele die wegen der Ausbildung nur blockweise in der Schule sind und sich dadurch halt weniger engagieren und glauben, dass es für sie ja gar nichts bringt, da sie nur so wenig in der Schule sind. Wir haben auch die sozialpädagogischen Assistent*innen bei uns an der Schule, die sind auch einmal in der Woche im Betrieb – und das führt halt dazu, dass es schwierig wird als Gruppe, Termine für aula-Meetings zu finden. Deshalb besteht die Gruppe oft nur aus Schüler*innen, die immer an der Schule sind.“
Tümen: „Also aus Spaß haben Lehrkräfte auch gesagt, dass sie uns sonst durchfallen lassen, damit wir für aula bleiben, wenn wir keinen Nachwuchs finden.“ [beide lachen]
Birhat: „Im Sommer veranstalten wir ein Tischtennisturnier und da haben wir ein aula-Werbetag. Da machen wir ein großes Turnier, dass wirklich alle Schüler*innen auch vor Ort sind und wir versuchen an dem Tag Schüler*innen in unser Team zu bringen.“
Tümen: „Als Aktion haben wir auch geplant, dass jeder der am letzten aula Meeting teilnimmt eine weitere Person mitbringen muss. Die dann hoffentlich joined.“
Birhat: „Ich bin davon überzeugt, dass es auch nach uns weiterläuft. Das Demokratiedenken ist wichtig, und das merken ja auch viele der anderen Schüler*innen. Wenn sich neue Schüler*innen unsere Schule angeschaut haben, am Tag der Offenen Tür, dann haben wir ihnen auch immer aula vorgestellt, und sie waren davon auch alle begeistert. Ich denke, wenn wir von Anfang an den neuen Schüler*innen aula zeigen und erklären, weil viele kennen das ja vorher nicht, und denen direkt die Möglichkeit geben mitzumachen, und dabei zu sein, dann haben viele ja auch drei Jahre Zeit etwas mitzugestalten. Ich glaube dann kriegt man das ehrlich hin.“
Zum Abschluss haben wir die beiden gefragt, was sie persönlich aus der Zeit im aula-Team mitnehmen — und was davon über den Schulalltag hinaus bleibt.
Lernen fürs Leben – Was bleibt persönlich?
Tümen: Ich find es eigentlich ganz interessant, also im aula Team und dann auch so allgemein, mit den Lehrkräften zu kommunizieren. Denn es war immer so eine Hierarchie da, zwischen dem Lehrer*innen-Schüler*innen Verhältnis und jetzt, also vor allem im aula Team, aber auch dann später hat sich das auch auf die SMV-Arbeit übertragen, dass wir untereinander uns alle geduzt haben, damit wir auf Augenhöhe sind. Das ist eine Sache die wir aus den vielen Barcamps auch mitgenommen haben. Durch aula sind wir oft auch bei Netzwerktreffen gewesen. Und haben so an anderen Orten aula erklärt und vorgestellt, und mussten auch mit Skeptikern umgehen lernen. Dabei haben wir viel gelernt auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch Präsentationen und Barcamp-Sessions zu halten.
Ein Highlight war auch definitiv, dass dadurch, dass wir so viel Praxis hatten, unsere Präsentationen immer besser wurden. Wir waren auch an einer anderen Schule und haben uns für die Präsentation einfach direkt deren Leitbild genommen und ihnen daran gezeigt, dass sie ja viel über Demokratie reden – aber dass sie es mit aula dann auch konkret umsetzen können.”
Birhat: „Ich sehe es bei mir und auch bei anderen aus der Klasse, wir sind engagierter geworden, auch für andere Themen aus dem Leben. Ich kann mir vorstellen auch nach der Schule etwas nebenbei für die Gesellschaft zu tun. Vor allem für die demokratische Teilhabe.
Durch aula habe ich erfahren, wie viel Vertrauen Lehrkräfte einem schenken können – das hätte ich vorher nicht gedacht! Ich war zwar schon Klassensprecher, aber die Art, wie durch aula das Vertrauen in mich gewachsen ist, war für mich völlig neu. Im Nachhinein finde ich es krass: Wir durften unsere Schule auf Veranstaltungen repräsentieren! Heute halte ich selbstbewusst Präsentationen – auch vor fremden Lehrkräften und Schüler*innen.“
Tümen: „Es war auch krass! Wir wurden zu einem ausschließlich für Lehrkräfte gedachten Barcamp eingeladen und durften dort unsere Schule vorstellen.”
Tümen: „aula hat auch dazu geführt, dass wir auch andere Dinge in die Hand genommen haben. Zum Beispiel wollten wir eine Weihnachtsfeier mit Waffelverkauf und gemeinsamen Singen, aber die Lehrerin war dann irgendwie immer nicht da, und es ging nicht voran. Und dann hatten wir erst Angst, dass es deshalb ausfällt. Aber wir waren dann so empowert, dass wir alles ohne sie arrangiert haben. Ich habe dann einfach meine Ukulele mitgenommen und wir haben dann trotzdem alles gemacht. Wir haben dann Waffeln und Punsch verkauft und das eigenständig vor den Ferien umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ohne die Erfahrung von aula, wir das so trotzdem getan hätten.“
Birhat: „aula ist da, damit Schüler*innen Demokratie erleben und zeigt einem wirklich wie Demokratie funktioniert. Denn es ist ja nicht so: Man wünscht sich die Tischtennisplatte und dann ist sie da. Es ist nicht alles einfach, sondern man muss dafür kämpfen, mit der Schulleitung sprechen, Argumente liefern, Mitbefürwörter*innen finden, darüber diskutieren und verhandeln können, und dadurch lernt man die Prinzipien von demokratischem Handeln.“
Danke an Tümen und Birhat für die Offenheit, euer Engagement während euer Schulzeit und die vielen konkreten Einblicke — und an die Edith-Stein-Schule dafür, dass Schüler*innen dort Verantwortung übernehmen können und Beteiligung im Alltag Raum bekommt.
Erfahren mehr über den aula-Einsatz an der Edith-Stein-Schule Freiburg – direkt auf der offiziellen Schulwebsite.
Hinweis: Das Interview wurde redaktionell überarbeitet und ist ein Ausschnitt aus einem aufgezeichneten Gespräch das über Videocall, dass durch das aula Team transkribiert und redigiert wurde. Fotoquelle: https://www.ests-freiburg.de/images/inhaltsbilder/schulleben/aula/Barcamp/20240701_BarcampI.jpeg
Wenn du dir vorstellen kannst, solche Strukturen auch an deiner Schule zu stärken, melde dich gern bei uns: Wir teilen Erfahrungen, Materialien und nächste Schritte, wie Beteiligung nicht nur möglich, sondern verlässlich wird. 💚🦉
Beyond the Feed
aula Beteiligungsaktion zu Social Media bis 30. März
Nehmt an der aula Social-Media-Umfrage teil – die Aktion läuft bis 30. März 2026! Danach wertet aula eure Stimmen aus und übergibt die Ergebnisse direkt an die Politik.

Beyond the Feed
Schüler*innen zur Social-Media-Debatte einbeziehen
Social Media prägt den Alltag beim Chatten Scrollen Posten. Doch was nervt oder belastet junge Menschen an Social Media und was begeistert sie? In mehreren Bundesländern wird die Smartphone-Nutzung in Schulen reguliert und derzeit wird auch über ein allgemeines Social Media Verbot für Jugendendliche (ab einem bestimmten Alter) debattiert.
Für mehr Partizipation in der Debatte
Wir bei aula glauben, dass Schüler*innen mit einbezogen werden müssen, wenn es um den Umgang mit der privaten Nutzung von Social Media Apps geht. Oft steht die Annahme im Raum, dass junge Menschen zum Beispiel eine Einschränkung pauschal ablehnen würden. Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass junge Menschen sehr genau wissen, welche Aktivitäten ihnen guttun und welche emotionalen oder sozialen Bedürfnisse sie wirklich erfüllen.
Aus der Erfahrung mit aula wissen wir zudem: Junge Menschen akzeptieren und halten Regelungen viel besser ein, wenn sie verstehen, woher eine Regel kommt, aktiv mit einbezogen wurden und wissen warum sie beschlossen wurde.
DEINE STIMME ZÄHLT!
Jetzt bist du dran! Du bist zwischen 6 und 22 Jahren alt? Dann sag uns deine Meinung zu Social Media! Was nervt dich, was begeistert dich? Oder sag uns wie du dir die perfekte Social Media App vorstellst.
So machst du mit:
- Umfrage öffnen: aula.limesurvey.net/beyondthefeed
- Fragen ehrlich beantworten
- Andere motivieren mitzumachen!
Wir sind gespannt auf die vielen Antworten von euch!
Was wir noch sagen wollten: Per gesetzlicher Definition gilt in Deutschland als junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. Als Organisation aula interessiert uns im Besonderen die Aussagen von Menschen, die im Schulalter sind, also im Alter von 6 bis 22 Jahren.
Falls du älter als 22 bist, freuen wir uns trotzdem riesig über deine Teilnahme und deine wertvolle Meinung!
Denn jede Stimme bereichert unsere Aktion und hilft, ein vollständigeres Bild zu zeichnen!
Lieber analog mitmachen?
Anstatt bei der aula-Beteiligungsaktion online mitzumachen, haben wir auch eine Version auf Papier für euch vorbereitet. Dafür könnt ihr den Fragebogen für euch herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und ein Foto/Scann davon an uns zurück schicken. Oder ihr tragt eure Ergebnisse auf dem Plakat zusammen und schickt uns davon ein Foto.
- hier könnt ihr den Fragebogen herunterladen
- Hier ist das Plakat zum download, dass sich gut in A1 ausdrucken lässt
Sendet das Foto und eure Antworten an: info@aula.de Betreff: Beyond the Feed
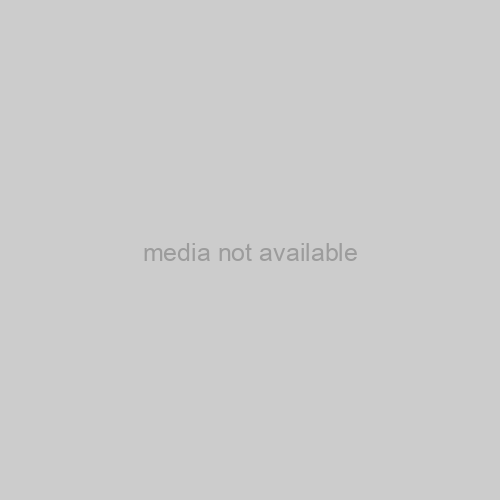

„Ich finde, die Aufmerksamkeit für die Meinung der Jugendlichen zu ihrem eigenen Lebensraum, dort, wo sie Expert*innen sind, sollte nicht nur an einem Tag stattfinden, sondern wir müssen die Strukturen verändern, die die Stimmen von Schüler*innen sichtbar machen.”
Marina Weisband, Mitgründerin von aula, Psychologin und Speakerin
Sei Türöffner*in für Veränderung! 🌱
Dein Netzwerk erreicht junge Menschen und Schüler*innen? Großartig – gemeinsam machen wir’s laut!
Hier kannst du direkt loslegen:
- Teile unsere Sharepics (download) in deinem Netzwerk
- Der Link direkt zur Online-Umfrage
- oder Schick den Link zu dieser Seite weiter: aula.de/beyond-the-feed
Lasst uns gemeinsam 1000 Stimmen sammeln – gemeinsam mehr erreichen! 🦉
Wir brauchen deine Unterstützung!

Danke fürs Teilen oder Mitmachen!
Euer aula-Teams!
Jahresrückblick 2025 – Demokratie leben, entwickeln, gestalten
2025 war für aula ein Jahr voller Veränderungen, Kooperationen und inspirierender Begegnungen. Gemeinsam mit Schulen, Partner*innen und jungen Menschen haben wir die digitale Demokratiebildung weiterentwickelt und neue Wege der Beteiligung geschaffen.
Neue Gesichter, mutige Schritte und erste Male
Schon im Januar begann das Jahr mit einem besonderen Meilenstein: Jonathan, unser erster Schülerpraktikant, brachte frische Perspektiven ins Team – und zeigte, wie früh Begeisterung für Demokratiearbeit geweckt werden kann. Gleichzeitig starteten wir die Arbeit an unserem neuen Corporate Design (CI), das aula einen modernen, klaren Auftritt verleiht. Mit dem Start der Kooperation mit „Zukunft D“ setzten wir den Kurs für langfristige Partnerschaften in der demokratischen Bildung. Unser Dank geht an unsere Partner*innen Algorithm Watch, Liquid Democracy, Wikimedia Deutschland und der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa, die Zukunft D gemeinsam mit uns mit Leben füllen und an das BMBFSFJ, das diese Intitiative mit seiner Förderung erst möglich gemacht hat!
Im Februar begrüßten wir Vera als Verstärkung. Zudem entschieden wir uns bewusst, den Didacta-Preis abzulehnen – ein starkes Zeichen für Haltung und Authentizität. Eine weitere Online-Botschafter*innen-Ausbildung stärkte unsere digitale Community und leitete ein Jahr voller Bildungsimpulse ein.
Bildung bewegt – von Berlin bis Freiburg
Der März brachte Bewegung ins Jahr: Michel und Lisa reisten nach Rheinland-Pfalz, wo sie mehrere Schulen besuchten. Außerdem kam Anika neu ins Team, was unsere Bildungsarbeit weiter stärkte.
Im April folgten gleich zwei Highlights für das Team: Nikola startete offiziell bei aula, und Jannis feierte sein Comeback – diesmal als Praktikant. Das Barcamp in Freiburg unterstrich, wie wichtig Austausch und Netzwerke in der Demokratiebildung bleiben.
Unser erster Community-Tag
Der Mai stand im Zeichen von Innovation und Gemeinsamkeit. Beim ersten Community-Tag und mit der neuen aula-Version 🦉📲 war deutlich zu spüren, was digitale Beteiligung bewirken kann.
Das Zukunftsfestival in Lüneburg und der Zukunft D-Workshop auf der re:publica brachten aula auf große Bühnen – und in viele neue Köpfe.
Im Juni folgte ein ungewöhnlich charmantes Teammitglied: Ruby, unser Bürohund, zog ein und stärkte (nicht nur) die Teamkultur. Bei einem Kaffee-Workshop mit Caventura ging es dagegen um Genuss, Nachhaltigkeit und Austausch!
Verstetigung, Förderung und neue Formate
Im Juli besuchten wir Teach First Deutschland in Hamburg und Karlsruhe und freuten uns besonders über die Verlängerung unserer institutionellen Förderung durch die Schöpflin Stiftung. Mit dieser Unterstützung können wir unsere pädagogischen Materialien weiterentwickeln und mehr Lehrkräfte in ganz Deutschland erreichen.
Der August brachte dann den Abschluss unserer neuen CI – visuell klar, freundlich und nahbar, entwickelt mit Sonja Lorenz.
Alexa Schaegner: „Die Förderung durch die Schöpflin Stiftung stärkt unsere Arbeit entscheidend. Sie ermöglicht es uns, unser Beteiligungskonzept qualitativ weiterzuentwickeln, neue Zielgruppen zu erreichen und unsere Kompetenzen im Team weiter auszubauen.“
Demokratie lernen durch Erfahrung
Der September war geprägt von Begegnung und Bildung:
- Teach Democracy Akademie in Potsdam mit rund 30 Fellows,
- Botschafter*innen-Ausbildung in Rheinland-Pfalz,
- und ein herzlicher Teamtag in Berlin – inklusive Stadtführung und Grillfest.
Im Oktober folgte der Postcode-Partnertag, bei dem wir nicht nur Inspiration, Vernetzung und eine große Wertschätzung spüren konnten. Zeitgleich liefen die erste Ausbildung mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und das Pilotprojekt zum Grundschulkonzept in Münster an – wichtige Schritte, um Beteiligung schon im frühen Schulalter zu fördern.
Abschluss mit Haltung, Humor und Herz
Der November brachte digitale Präsenz und Sichtbarkeit: Vom Digital Democracy Day über den Charity-Twitch-Stream bei Bonjwa – bei dem für alle teilnehmenden Organisationen über 120.000€ gespendet wurden – bis hin zum Schulbesuchen in Leipzig. Ein starkes Zeichen, wie vielfältig Demokratiebildung heute sein kann.
Im Dezember wurde es festlich: Weihnachtsfeier mit Karaoke, Teamfreude pur – und der Abschluss der Botschafter*innen-Ausbildung in Niedersachsen, der das Jahr rund machte. Insgesamt konnten wir in diesem Jahr 60 neue Botschafter*innen ausbilden.
Danke für Vertrauen, Förderung und Wirksamkeit
Ohne unsere Förderpartner*innen und die zahlreichen Unterstützer*innen wäre all das nicht möglich: Herzlichen Dank an die Schöpflin Stiftung, die Postcode Lotterie, das BMBFSFJ, die Robert-Bosch-Stiftung, das ZSL Baden-Württemberg und viele weitere Partner, Spender*innen und Unterstützer*innen, die uns ermöglichen, digitale Demokratiebildung und Jugendbeteiligung nachhaltig zu gestalten.
2025 war ein Jahr der Entwicklung – 2026 wird ein Jahr der Umsetzung. Wir freuen uns darauf, weiter gemeinsam mit Schulen, Jugendlichen und Partner*innen Demokratie lebendig zu machen.
Simone (aula-Botschafterin): „In der Zusammenarbeit mit den Menschen, die aula an ihrer Schule einführen möchten, beeindruckt mich das Durchhaltevermögen, der unbedingte Wille Veränderung und Demokratie zu leben. Und auch hier das sehr wertschätzende Miteinander. Es macht Freude zu sehen, wie Schüler*innen beginnen auf neue Art miteinander und mit den Lehrkräften und die Lehrkräfte mit den Schüler*innen zu kommunizieren.”
Spende als Geschenk: Demokratiebildung für Kinder – Dein sinnvolles Weihnachtsgeschenk
Hallo lieber Mensch, du suchst ein besonderes Geschenk, das nicht nur Freude macht, sondern auch etwas verändert? 🎁
In der besinnlichen Jahresendzeit fragst du dich vielleicht: Was bleibt wirklich, wenn die Lichterketten erlöschen? Eine Geschenk-Spende an aula – das ist dein Geschenk mit bleibender Wirkung. Du stärkst damit Demokratiebildung in Schulen und schenkst Kindern echte Selbstwirksamkeit: Sie lernen, gehört zu werden, Ideen einzubringen und mitzugestalten.
Warum deine Spende Demokratiebildung verändert
-
Für Schüler*innen: Sie erleben Mitbestimmung im Schulalltag – von der Grundschule an.
-
Langfristig wirksam: Du förderst resiliente Gestalter*innen von morgen.
-
Einfach & herzlich: Dein Beitrag erreicht mehr Schulen 2026.
So schenkst du Demokratiebildung –
in 3 Schritten
-
Spende jetzt unter www.aula.de/spenden
-
Lade deine personalisierbare Geschenk-Urkunde direkt hier herunter (PDF).💡 Hinweis: Die Urkunde dient als herzliches Geschenk – sie gilt nicht als steuerlicher Nachweis. Den erhaltst du als Spender*in von uns per E-Mail.
-
Drucke sie liebevoll aus, falte sie elegant und überreiche sie deinem Herzensmenschen. 🦉💚
Du machst Schenken sinnvoll – für Kinder, Schulen und Demokratie.
Die Schüler*innen von heute sind die Gestalter*innen von morgen. 💪
👉 Jetzt spenden und Urkunde herunterladen
www.aula.de/spenden
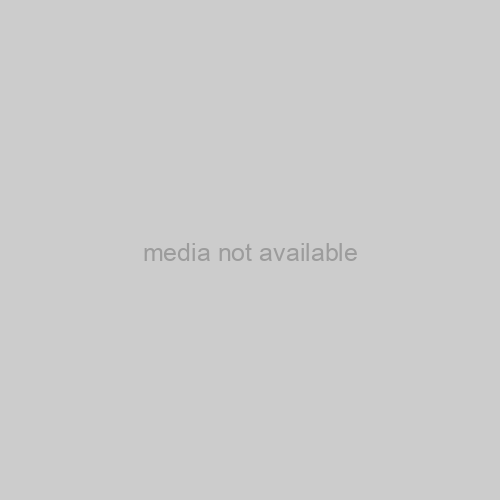
9. Dezember 2025
Mehr Eulen-Power für die Zukunft
Wie aula fliegen gelernt hat
und warum Paula unersetzlich ist

Das Jahresende steht vor der Tür. Es ist die Zeit der Jahresrückblicke, der vielen Klassenarbeiten und des ersten Schnees. Während sich viele Tiere bereits in den Winterschlaf verabschiedet haben, bleiben die Eulen das ganze Jahr aktiv — so auch das aula Team.
Du hast dich schon immer gefragt, warum unser Logo eine Eule zeigt und sie immer wieder auftaucht? Wir freuen uns, sie dir heute vorzustellen. Unsere Eule heißt Paula!
Seit über 10 Jahren begleitet Paula unsere beiden Gründerinnen. Glaubt uns, sie hat in dieser Zeit mehrfach ihr Aussehen verändert. Gemeinsam mit dem aula Team fliegt Paula verschiedene Schulen an und ermöglicht Schüler*innen Mitbestimmung. Was Paula schon alles erlebt hat?
Darüber haben wir mit den beiden Gründerinnen Marina Weisband und Alexa Schaegner gesprochen,die ‘Paula’ sozusagen das Fliegen beigebracht haben. Sie sind mit ihr zusammen gewachsen und konnten Erfahrungen sammeln, um zu wissen, was es braucht, um weiter mit so viel Energie neue Schulen anfliegen zu können.
Was hat eine Eule mit Demokratiebildung zu tun?
Alexa Schaegner: Ich mag das Bild der Eule. Sie sind klug, wachsam, sie können den Kopf in alle Richtungen drehen. Sie können sogar im Dunkeln noch klarsehen. Und irgendwie sind sie auch ein bisschen schräg und lustig. Außerdem, wenn Eulen in Gruppen zusammenkommen, nennt man das „Eulen-Parlament“- Kein Witz.
Marina Weisband: Die Eule als Tier Athens ist seit Altertum ein Symbol der Weisheit und auch der klassischen Demokratie. Sie wird auch oft als Lehrer dargestellt, da ist die Verbindung zur Schule. Soweit die offizielle Variante. Heimlicher echter Grund: Eulen sind cool.
Wie hat Paula das Fliegen gelernt und es geschafft, an inzwischen schon über 50 Schulen zu landen?
Alexa: Paula ist vor etwas über 10 Jahren bei uns im Team geboren – aus der Überzeugung heraus, dass Schülerinnen mehr Mitbestimmung brauchen, und dass Schulen dafür gute, praxistaugliche Werkzeuge brauchen. Fliegen gelernt hat sie durch mutige, engagierte Lehrkräfte, Schulleitungen und Schülerinnen, die nicht nur gesagt haben „Demokratie ist wichtig“, sondern bereit waren, sie wirklich auszuprobieren. Und irgendwann war Paula einfach so oft unterwegs, dass sie sich ihren Weg fast automatisch an die nächste Schule gebahnt hat.
Marina: Sie hat zuerst in die Tiefe gearbeitet und dann in die Breite. Zuerst haben wir jahrelang mit wenigen Schulen geschaut, ob und wie das Konzept gut funktioniert. Und jetzt schicken wir lauter Eulen (lacht und meint Botschafter*innen) in alle Himmelsrichtungen aus, die immer mehr Schulen onboarden können.
Welche Situationen und Momente geben euch und Paula die Kraft, trotz Gegenwind, weiterzufliegen?
Alexa: Es sind diese kleinen Momente. Wenn ein Schüler sagt: „Ich wusste gar nicht, dass ich wirklich etwas verändern kann.“ Wenn eine Lehrkraft nach einem anstrengenden Tag meint: „Okay, das war jetzt Arbeit, aber es hat sich gelohnt.“ Und auch das Feedback aus Schulen, die mit aula schon große Fortschritte gemacht haben, das trägt uns und macht Mut!
Marina: Paula ist gern unter Schüler*innen. Egal wie ätzend die umgebenden Umstände sind, die Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein junger Leute flashen uns immer wieder. Wir wissen, dass es richtig ist, was wir tun.
Was braucht Paula, damit sie weiter und schneller fliegen kann?
Alexa: Ganz ehrlich: Zeit, Ressourcen und Menschen, die an sie glauben. Wir sind ein kleines Team, aber wir arbeiten mit einer großen Leidenschaft. Wenn Paula noch weiter fliegen soll – und schneller, dann braucht es mehr stabile Förderung, mehr Partner*innen, die Demokratie nicht nur als Schlagwort, sondern als Aufgabe verstehen. Und natürlich Schulen, die sagen: „Wir trauen uns.“
Marina: Paula braucht Verbündete. Leute, die an echte Beteiligung glauben. Seien es Schulleitungen, Botschafterinnen, Spenderinnen, engagierte Lehrkräfte und Schüler*innen. Jeder kann etwas beitragen.
Warum brauchen wir insgesamt mehr Eulen-Power?
Alexa: Weil Demokratie nicht von allein stabil bleibt. Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich zutrauen, Verantwortung zu übernehmen, Fragen zu stellen, die in den Schulen und auch in unserer Gesellschaft oft untergehen. Fridays for Future ist dabei nur ein Beispiel, das bis heute unfassbar inspirierend ist. Mehr Eulen-Power heißt: Bedingungen schaffen für Neugier, Haltung, Selbstwirksamkeit – davon können wir im Moment wirklich nicht genug haben.
Marina: Autoritäre Kräfte haben sehr viel Power und Geld. Wir haben uns und die Überzeugung, dass die Gesellschaft nunmal alle braucht. Darum brauchen wir Beteiligung. „Du wirst gebraucht!“ ist die stärkere Geschichte als „Die da oben sind schuld.”
Mehr Eulen-Power, das brauchen wir jetzt! Damit Paula, unsere Eulen und das ganze aula Team weiter fliegen kann –für mehr Mitbestimmung und Selbstwirksamkeit in der Schule.
Bildung braucht Zeit, Ressourcen und mutige, engagierte Menschen, die Veränderungen vorantreiben. Und Bildung braucht Unterstützung – mit Deiner Spende förderst Du die Befähigung junger Menschen zu mehr Selbstwirksamkeit.
Mehr Eulen-Power – und zwar jetzt!
Damit Paula, unsere Eulen und das ganze aula Team weiterfliegen können, brauchen wir Deine Unterstützung. Jede Spende hilft uns, junge Menschen in Schulen zu befähigen, Mitbestimmung zu erleben und Selbstwirksamkeit zu entwickeln.
Bildung braucht Zeit, Ressourcen und mutige Menschen, die Veränderungen vorantreiben. In diesem Jahr konnten wir dank Unterstützer**innen so viel schaffen*– mit Deiner Spende können wir noch mehr erreichen.
Du machst den Unterschied!
Spende jetzt und ermögliche, dass Paula und das aula Team weiterhin neue Schulen anfliegen – für mehr Mitbestimmung, Engagement und Selbstwirksamkeit:
➡️ Hier spenden: aula.de/spende
Deine Stimme. Deine Bildung. Unsere Zukunft
Visionen für die Bildung von Morgen.
Aktion zum Internationalen Tag der Bildung am 24.01.2026
Für Schüler*innen
Wir glauben: Ihr wisst genau, was euch fehlt, damit Schule ein besserer Lernort wird.
Sprecht euch mit euren Mitschüler*innen ab oder beantwortet die Frage allein:
👉 Was muss sich an deiner Schule ändern, damit Lernen mehr Freude macht?
So könnt ihr mitmachen:
-
digital über den QR-Code
-
oder mit dem Plakat zum Ausdrucken
📷 Schickt ein Foto eures Plakats an: info@aula.de
📢 Teilt die Aktion in eurer Schule – denn:
Je mehr Stimmen, desto besser!
Für alle, die an einer Schule arbeiten
Wir wollen hinhören.
Wir möchten wissen, was Schüler*innen an ihrer aktuellen Situation in der Schule ändern wollen, welche Erwartungen sie haben und welche Ideen und Wünsche sie für die Zukunft mitbringen.
Deshalb stellen wir die zentrale Frage:
Was muss sich an deiner Schule ändern, damit Lernen mehr Freude macht?
Diese Frage können Schüler*innen gemeinsam oder allein beantworten:
🗓 Bis Mitte Januar sammeln wir alle Antworten.
Bitte schickt ein Foto der ausgefüllten Plakate an: info@aula.de
Am 24. Januar veröffentlichen wir die Ergebnisse gesammelt und anonym – um sichtbar zu machen, was Schüler*innen wirklich brauchen.
Hinweis:
Aus organisatorischen Gründen werden wir Die Antworten Clustern und eine Auswahl der eingereichten Beiträge treffen. Die Veröffentlichung erfolgt gesammelt und anonym. Antworten können bis zum 17. Januar eingereicht werden.
Danke, dass ihr eure Stimme mit uns teilt –
denn: Eure Meinung zählt.
Blick ins Schulklo
Blick ins Schulklo – Welttoiletten Tag 2025
Fakten zum gar nicht so stillen Örtchen: Wusstest du, dass 60% der Schulleitungen angeben, dass die Sanitären Anlagen nicht vollständig funktionsfähige sind? Das 50% der Schüler*innen das Gefühl haben, dass sich nicht gut um das Schulklo gekümmert wird und dass das Schulklo die Durschnittsnote 4,4 bekommen würde? Das hat 2022/23 die Studie „Toilette macht Schule“ veröffentlicht und wir sehen – viel hat sich seitdem nicht geändert.
Wir haben uns umgehört und Stimmen aus der Schule gesammelt. Mit dabei Luisa E.Galli. und ein Beitrag aus einer aula-Schule. Die Schüler*innen haben sich das Schulklo auf die Agenda gesetzt! Doch schaut selbst:
© FWU Institut für Film und Bild, 2025 und den Schnitt Videodreh & Schnitt Martin Viktor-Nudow.

Stimme aus der Schule
Luisa E. Galli ist 18 Jahre und hat schon öfter öffentlich auf Bühnen über die Schultoilette gesprochen. Sie setzt sich neben der Schule für mehr Selbstwirksamkeit im Schulkontext und politische Beteiligungsmöglichkeiten ein. Sowie eine Videobotschaft
Wir haben Luisa gefragt:
Für welches Thema bzw. welche Themen setzt du dich im schulischen Kontext ein – und seit wann?
Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass Schüler:innen im System Schule ernster genommen werden und nicht nur als Empfänger von Entscheidungen auftreten. Ausschlaggebend für diese Haltung war meine Schulsprecher:inwahl, die ich mit 13 Jahren gewonnen habe. Ich konnte in meiner Amtszeit einige Projekte anstoßen, aber ich habe mich trotzdem oft machtlos gefühlt. Ein Thema, das mir in der Zeit aber immer wieder aufgefallen ist, waren die vernachlässigten Schulklos. Nicht nur an meiner Schule, sondern überall. 2024 habe ich diese Erkenntnis zum ersten Mal öffentlich thematisiert beim Reeperbahn Festival mit meinem Talk „Warum Schulklos politisch sind“. Ich war mit 16 Jahren die jüngste Speakerin dort, der Raum war voll, und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, einen Punkt getroffen zu haben, der viele junge Menschen bewegt, aber nie laut ausgesprochen wird. Seitdem werde ich oft zu Beteiligungsformaten eingeladen, um genau darüber zu sprechen.
Was ist aktuell auf der Schultoilette los?
Die Schultoilette wirkt auf den ersten Blick wie ein unscheinbarer Ort, aber sie zeigt ziemlich genau, wie es einigen Lernenden dort geht. Viele Toiletten sind schmutzig und einfach kein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Dazu kommen oft Sticker mit politischen Forderungen. Für mich war also schnell klar, dass das kein reiner Vandalismus, sondern ein Ausdruck von Machtlosigkeit ist. Davon, dass Schulklos politisch sind. Ich war darüber nie wütend, sondern eher empathisch. Denn bis jetzt existieren kaum Wohlfühlräume oder Beteiligungsformate in Schulen, die nicht durchgehend von Lehrkräften kontrolliert werden. Die Toiletten spiegeln also, wie wenig Mitgestaltung im restlichen Schulalltag möglich ist.
Welche konkreten Maßnahmen braucht es deiner Meinung nach jetzt?
Ich wünsche mir zuerst, dass wir ehrlich darüber reden, warum Schulklos so aussehen, wie sie aussehen. Nicht im Sinne von „Wer ist wieder Schuld an dem Dreck?“, sondern eher: „Was müsste aus eurer Sicht anders laufen, damit ihr euch an der Schule gehört fühlt?“. Viele junge Menschen wissen nicht, dass sie ein Recht auf Beteiligung haben, deshalb versuche ich in meiner Arbeit genau dafür zu sensibilisieren.
In der Praxis heißt das Recht für mich, dass Schüler:innen mitentscheiden dürfen, wie die Toiletten bei ihnen aussehen sollen. Das klingt vielleicht banal und das kann ich verstehen. Wirklich. Der entscheidende Punkt ist aber, dass jede Mitgestaltung die eigene Haltung verändert. Denn wer selbst mitgestaltet, übernimmt automatisch mehr Verantwortung. Ich spreche oft mit Lernenden und Lehrenden an Schulen, bei denen die Klos ein zentraler Störfaktor waren. Dann gab es aber eine Zusammenarbeit aller Beteiligten auf Augenhöhe und ohne Bestrafungen. Als Konsequenz verschwanden viele Symptome wie beschmierte Türen oder kaputte Spender von allein, weil die Ursache, also das Gefühl von Machtlosigkeit, nicht mehr im gleichen Ausmaß da war. Ich wünsche mir für die Zukunft ein inklusive Schulsystem, dass junge Menschen nicht als Störfaktor sieht, sondern einfach als Menschen, die Teil der Schule sind. Genauso wie alle anderen.
Die Schultoilette ist der erste (halb-) öffentliche Ort, an dem junge Menschen lernen ohne Aufsicht mit Gemeingut umzugehen. Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass die Toilette ein Ruhe-oder Rückzugsraum ist. Besonders wenn es vielleicht in der Schule keinen solchen Raum gibt. Natürlich wird dann daraus auch ein Ort, an dem Frust abgelassen wird. Dies hat auch weiter Folgen. Ist die Toilette aufgrund von Vandalismus nicht mehr zugänglich oder verdreckt, hat das auch Folgen für die Gesundheit, die von Konzentartionsstörungen bis hin zu Blasenentzündungen und Infektionskrankehiten gehen können. Für Menstruierende kann ein fehlender hygienischer Ort zum kümmern um die Periode auch schwere Folgen haben.
Danke, Luisa! Für dein Engagement und deine Zeit uns diese Frage zu beantworten. 💚🦉
Das Schulklo ist kein unpolitischer Ort. Wenn Schüler*innen mitreden und mitgestalten, verändert sich nicht nur der Raum – es entstehen Antworten auf Probleme, die lange übersehen wurden.
Bildung braucht Fragen. Und Menschen wie dich, die Antworten möglich machen.
Deine Spende stärkt Projekte, in denen junge Menschen ihre Schule verbessern – vom Schulklo bis hin zu Schulentwicklung auf großer Ebene.
Mach den Unterschied. Spende jetzt.
👉 aula.de/spenden
Rund ums Schulklo:
- https://germantoilet.org/de/schulen/toiletten-machen-schule-studie/
- https://www.gew-berlin.de/aktuelles/detailseite/periode-als-klassenfrage
- https://www.germantoilet.org/de/fortbildung/grundlagenkurse-wash/seminar-wash-in-schulen-und-institutionen-ablaufplan/
- https://www.ellas-welt.org
- https://media.germantoilet.org/pages/schulen/toiletten-machen-schule-studie/2242471965-1692953784/tms_studie_2022-2023.pdf
Mit besten Dank an das Medieninstitut der Länder FWU. FWU Institut für Film und Bild www.fwu.de und die Bereitstellung des Video-Materials aus: Politische Partzipation, © FWU Institut für Film und Bild, 2025 und den Schnitt Videodreh & Schnitt Martin Viktor-Nudow.
Wenn Schüler*innen gestalten: ein Weg zu Motivation und Resilienz
Wir, das sind Alexa Schaegner und Marina Weisband, die Gründerinnen von aula. Wir haben keine Lust mehr, dass das Thema Bildung auf der Stelle tritt, deshalb haben wir vor über 10 Jahren aula gegründet. Unser innovatives und digital gestütztes Beteiligungskonzept, das Schüler*innen Selbstwirksamkeitserfahrungen im Alltag ermöglicht und sie befähigt, zu Gestalter*innen ihrer Welt zu werden. Unserer Welt.
aula, das Beteiligungskonzept beruht auf drei Säulen:
- dem aula-Vertrag, der als Selbstverpflichtung der Schule den Rahmen der Beteiligung setzt
- unserer Online-Plattform, die somit allen Schüler*innen Beteiligung ermöglicht
- didaktischen Materialien für die ‘aula-Zeit’, in der über den Prozess auf der Plattform, aber auch über Themen rund um Partizipation und Teilhabe gesprochen werden kann.
Wir bei aula sind davon überzeugt, dass eine Schule einen offenen und mutigen Raum für Bildung eröffnet, wenn sie sich auf den Weg macht, ihre eigenen Partizipationsstrukturen zu reflektieren, sich im Rahmen des aula-Vertrags bereit erklärt, entwickelte Ideen zu realisieren und sichtbar zu machen, sich Zeit nimmt, diesen Prozess zu begleiten, und den Schüler*innen den Raum gibt, sich mit ihren Ideen auseinanderzusetzen.
In Bildung steckt der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft und somit auch für die Demokratie, eine nachhaltige Entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe und die mentale Gesundheit – neben den klassischen Kompetenzen.
Studien zeigen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche an Burnout und Depression leiden. Die Anzahl hat sich von 2009 zu 2019 verdoppelt. Aus Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen, haben wir selbst erfahren, dass sie zum Beispiel wegen Prüfungsangst nicht schlafen können. Der Spaß am Lernen wird überschattet durch Druck und Angst.
Alexa Schaegner: „Wenn Kinder unter ständigem Druck stehen, verlieren sie nicht nur die Freude am Lernen, sondern auch das Vertrauen in sich selbst. Wir sehen jeden Tag, wie eng mentale Gesundheit und das Gefühl von Selbstwirksamkeit miteinander verknüpft sind. Kinder müssen erleben dürfen, dass ihre Stimme etwas bewirken kann – das ist kein Luxus, sondern eine Voraussetzung dafür, gesund aufzuwachsen.”
Schüler*innen signalisieren uns in der Zusammenarbeit bei Workshops, dass sie lernen wollen. Aber nicht umsonst! Viele Kinder bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil der Lernort Schule es nicht schafft, ihre Neugierde und Motivation zu wecken. Dabei sind Kinder doch von Prinzip aus neugierig.
Unsere eigene über 10-jährige Projekterfahrung und weitere Studien zeigen: Kinder, die regelmäßig mitgestalten, sind motivierter, resistenter und psychisch stabiler.
Marina Weisband: „Selbstwirksamkeit reduziert Stress und stärkt Resilienz. Kinder, die erleben, dass ihre Stimme zählt, wachsen über sich hinaus. Denn du bist hier nicht nur da, um Erwartungen zu erfüllen, sondern du bist Gestalter*in.“
Wenn wir doch wissen, dass Kinder über Beteiligung Selbstwirksamkeit erfahren können, müssen wir ihnen doch genau diesen Raum systematisch ermöglichen. Denn die Schule sollte uns nicht mehr unserer Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit berauben. Mit Aula bekommen Schüler*innen echten Mitgestaltungsspielraum: Sie entwickeln Ideen, stimmen darüber ab und setzen ihre Projekte um.
Bildung braucht Resilienz und mutige Menschen, die bereit sind für Veränderung. Bildung braucht Unterstützung – mit Deiner Spende unterstützt Du die Befähigung junger Menschen zu mehr Selbstwirksamkeit.
Junge Menschen wollen mitgestalten – geben wir ihnen den Raum dazu. Mit deiner Unterstützung wachsen Selbstvertrauen, Resilienz und Demokratie.
➡️ Jetzt spenden: aula.de/spende
➡️ aula an deiner Schule? Hier gehts zum Kontakt
x
8. November 2025
Bildung braucht Antworten - BNE
Die Welt verändert sich –
Bildung braucht Fragen. Bildung braucht Antworten.
Nachhaltige Entwicklung beginnt nicht von selbst – sie beginnt mit Menschen, die sie vorantreiben. Deshalb haben wir mit unserem aula-Botschafter Michael Jansen gesprochen.
Die Welt befindet sich im Wandel – und wir alle können dazu beitragen, Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit, politische Spannungen und ein schwindendes Vertrauen in Institutionen: Diese Entwicklungen betreffen uns alle. Sie verlangen nach Antworten, die über kurzfristige Lösungen hinausgehen.
Die Grundlage dafür liegt im politischen Handeln – doch ebenso entscheidend ist ein nachhaltiges Bewusstsein in der Gesellschaft. Genau hier setzt das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an: Es schafft die Voraussetzungen, um Wissen, Werte und Handeln für eine zukunftsfähige Welt zu verbinden.
Michael Jansen ist seit 2021 aula-Botschafter. Er engagiert sich für eine lebendige Ziviligesellschaft und nachhaltige Entwicklung. Als Lehrkraft ist ihm BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) ein besonders wichtiges Anliegen.
aula: Wer bist du und was machst du in einem Satz?
Michael: Ich bin Michael Jansen, arbeite als Lehrer und Zirkuspädagoge, komme aus dem Rheinland und engagiere mich in vielfältiger Weise für eine lebendige Zivilgesellschaft, insbesondere im Bereich der Bildung (für nachhaltige Entwicklung).
aula: Warum tust du, was du tust?
Michael: Meine Mission und mein Antrieb sind, meine Motivation, meine Talente, Fähigkeiten und Begabungen gemeinsam mit Anderen, für Andere, sinnvoll einzusetzen und dabei gemeinsam Freude und Begeisterung zu erleben und zu entfachen. Ich glaube, dass es für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften und ein gesundes, nachhaltiges Leben aller Menschen wichtig ist, dass wir uns alle, unseren Möglichkeiten entsprechend, für die Gemeinschaften lokal und global sowie für die Umwelt engagieren und das globale Zusammenleben für alle immer lebenswerter, gerechter, demokratischer, sozialer und ökologisch nachhaltiger gestalten. Hierzu braucht es uns alle.
aula: Was war der Wendepunkt oder Aha-Moment für dich?
Michael: Ich könnte hier mehrere Erlebnisse, Reden, Bücher oder Begegnungen nennen.
Besonders inspiriert haben mich aber Julia Engelmanns Poetry-Slam „Eines Tages, Baby“ beim 5. Bielefelder Hörsaal-Slam 2013, das Pinguin-Prinzip in einer Pinguin-Geschichte von Eckart von Hirschhausen und vor allem Rob Hopkins mit seiner „Transition-Town-Bewegung“ sowie ganz besonders sein Buch „Mit Mut und Phantasie die Welt verändern“.
aula: Seit wann bist du bei aula dabei und warum?
Michael: Ich bin seit 2021 bei aula mit dabei. Damals habe ich die Ausbildung zum aula-Botschafter gemacht.
Ich bin bei aula dabei, weil ich es wichtig finde, dass Schüler:innen in der Schule demokratische Werte lernen und beteiligt werden. Durch aula lernen sie, sich mit ihren Ideen einzubringen und machen so bereits in der Schule die wertvolle Erfahrung von Selbstwirksamkeit, wenn ihre Vorschläge gehört, ernst genommen und umgesetzt werden.
aula: Was bedeutet für dich Bildung für nachhaltige Entwicklung und was hat das mit deinem Engagement zu tun?
Michael: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bedeutet für mich eine transformative Bildung, die sich an der Agenda 2030 und der Berliner Erklärung orientiert und die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable **Development **Goals **(SDGs) umsetzt. Das Ziel ist eine Bildung, die eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung voranbringt. Alle Menschen sollen die Bedeutung und Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung verstehen. Durch BNE werden Fähigkeiten erworben, die es den Menschen ermöglichen, verantwortungsvolle Entscheidungen für eine nachhaltige Gegenwart und Zukunft aller lebendigen Wesen und des Planeten zu treffen und zu den SDGs beizutragen. In die Gesellschaften soll ein Wissen über Nachhaltigkeit vermittelt werden und dies soll zu einer kritischen Auseinandersetzung und einer Sensibilsierung für globale und lokale Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft beitragen. Die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Umwelt, auf Menschen an anderen Orten sowie auf zukünftige Generationen soll aufgezeigt werden. Dabei gilt es, die Nachhaltigkeitsdimensionen in ihrer Komplexität und gegenseitigen Abhängigkeit deutlich zu machen. Durch das Erlernen und Erfahren von transformativen Fähigkeiten, frohmachender Selbstwirksamkeit und gestalterischer Handlungskompetenz werden die Lernenden zu verantwortungsbewusstem, strukturveränderndem und zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt.
aula: Danke, Michael, dass du dich als aula-Botschafter für BNE und Mitbestimmung von Schüler*innen engagierst!
Bildung ist der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft. BNE muss daher stärker von Schulen fokussiert werden. Schüler*innen zu befähigen, sich zu beteiligen und nachhaltig bewusst zu handeln – das sollte genauso zur Bildung gehören, wie Gedichtsanalysen oder der Satz der Pytagoras.
schriftliches Interview: Jannis Döling für aula.

Nachhaltige Entwicklung: Wie wir Zukunft gemeinsam gestalten können
Die Welt verändert sich – und wir alle können einen Beitrag leisten, Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit, politische Spannungen und sinkendes Vertrauen in politische Institutionen. Diese Entwicklungen betreffen uns alle – und verlangen nach Antworten, die über kurzfristige Lösungen hinausgehen. Die Antwort dafür liegt im politischen Handeln. Entscheidend ist aber auch ein nachhaltiges Bewusstsein in der Gesellschaft. Das Konzept der “Bildung für nachhaltigen Entwicklung” (BNE) legt hierfür die Grundlagen.
Die Welt im Wandel - Wir brauchen nachhaltige Entwicklung
Nachhaltigkeit - das bedeutet inzwischen viel mehr als Ressourcen zu sparen. Es bedeutet, Klimaschutz, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzudenken. Ohne eine intakte Umwelt ist gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt nicht möglich. Gleichzeitig braucht es Lösungen, die wirtschaftliche Perspektiven weltweit erhalten – auch in Schwellen- und Entwicklungsländern.
Die Herausforderung liegt darin, ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander zu verbinden.
Wie kann Wachstum und Fortschritt gelingen, ohne dabei auf Kosten der zukünftigen Generation und des globalen Südens zu leben? Wie können wir international Menschen, Planeten, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft schützen und für alle ermöglichen? Mit diesen Fragen befassen sich die Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Die Regierungen der UN-Mitgliedsstaaten tragen die Hauptverantwortung für die Umsetzung der SDGs aber auch die Zivilgesellschaft ist dazu angehalten, ihren Beitrag zu leisten und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Damit nachhaltige Entwicklung gelingt, braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen und Veränderungen aktiv vorantreiben.
Nachhaltiges Bewusstsein lernen - wo, wenn nicht in der Schule?
Schulen sind Orte, an denen junge Menschen Kompetenzen fürs Leben erwerben. Über den Fachunterricht hinaus geht es darum, Werte und verantwortungsvolles Handeln zu vermitteln. Ein nachhaltiges Bewusstsein wächst nicht allein durch Faktenwissen über den Klimawandel oder globale Herausforderungen. Es entsteht dann, wenn wir lernen, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Dieser Lernprozess betrifft nicht nur Schüler*innen, sondern uns alle - und es bedeutet, dass wir
- Zusammenhänge zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft verstehen
- erkennen, dass heutige Entscheidungen das Leben von morgen prägen
- die Zukunft aktiv mitgestalten
Wenn Schulen Nachhaltigkeit im Alltag erfahrbar machen, befähigen sie junge Menschen, selbst aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Wenn die Welt sich verändern soll, muss auch Schule sich verändern
Schon seit den frühen 2000er Jahren fordert das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung einen sogenannten Whole-Institution-Ansatz. Schule müsse sich ganzheitlich verändern – also nicht nur im Unterricht, sondern in ihrer gesamten Organisation und Kultur –, um die Ziele nachhaltiger Entwicklung wirklich zu erreichen.
Hierzu gibt es bereits viele verschiedene Konzepte, zum Beispiel den Freiday. Ziel ist es, selbstbestimmtes, interessengeleitetes Lernen der Schüler*innen zu ermöglichen. Schulen, die dieses Modell anwenden, reservieren einen festen Zeitraum in der Woche – oft den Freitagvormittag –, an dem Schüler*innen frei an eigenen Projekten arbeiten können.
Doch Mitbestimmung von Schüler*innen sollte nicht nur an einem Tag in der Woche stattfinden - sie sollte dauerhaft gewährleistet sein. Eine gelebte Beteiligungskultur mit echter Mitbestimmung und erlebbaren demokratischen Prozessen schafft Raum für Selbstwirksamkeit – und damit für verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln. aula bietet dafür einen Anknüpfungspunkt und unterstützt die demokratische Ausgestaltung von Schulen. Dabei erfahren Schüler*innen Selbstwirksamkeit und erleben, dass ihr Handeln etwas bewirkt. Ideen werden auf der aula- Plattform nicht nur gesammelt, sondern auch gemeinsam diskutiert. Dabei konfrontieren Schüler*innen sich mit ihren unterschiedlichen Interessen und den Auswirkungen ihrer Ideen - und lernen so, verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Mit aula füllen wir BNE mit Leben. Nachhaltige Entwicklung beginnt nicht erst „irgendwann in der Zukunft“ – sie beginnt jetzt! Mit der nächsten Idee, der nächsten Abstimmung, der nächsten Entscheidung!
















